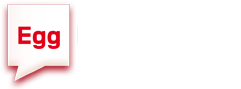Politbeitrag: Alaska war ein Schnäppchen
Diesen Beitrag fanden wir in der Neuen Zürcher Zeitung vom 1. Februar 2025 – von Stephan Bierling;
Warnung: der Beitrag ist nur für Interessierte und benötigt auch einige Minuten ihrer Zeit.
So abseitig sind Trumps Grönland-Ideen gar nicht – die USA haben sich mehr als die Hälfte ihres Territoriums zusammengekauft.
Baton Rouge, Saint Lous, Los Angeles, El Paso, Russian River – die Namen amerikanischer Städte, Dörfer und Flüsse dokumentieren, dass die Geschichte der Nation keine rein englische und protestantische ist. Hollywood hat die Geschichte der Ausbreitung der ursprünglich dreizehn Ostküstenstaaten bis an den Pazifik hundertfach inszeniert. Filme und TV-Serien zeigen den Strom mutiger Siedler entlang des Oregon oder des Santa Fe Trail zur anderen Seite des Kontinents, Eisenbahnbau und Indianerkriege. Der Historiker Frederick Jackson Turner erklärte schon 1893 das Verschieben geografischer Grenzen nach Westen und das Urbarmachen der Wildnis zur prägenden Erfahrung der Nation.
Was dabei untergeht, ist die andere, weniger heroische Seite der Expansion: Die USA kauften sich ihr Riesenland überwiegend zusammen. Die dreizehn Kolonien, die sich 1776 von Großbritannien unabhängig erklärten, waren mit 366 000 Quadratkilometern nämlich kleiner als Kalifornien. Seither wuchsen die USA um das 27-Fache auf fast 10 Millionen Quadratkilometer. Zwar waren ihnen durch den Sieg über die Briten 1783 deren Gebiete bis zum Mississippi zugefallen, aber ihre kontinentale Expansion nahm erst durch Landerwerb Fahrt auf.
Napoleon brauchte Geld
Den ersten Big Deal schloss 1803 Thomas Jefferson ab, Verfasser der Unabhängigkeitserklärung und dritter Präsident. Es ging um das Louisiana Territory, ein Gebiet von mehr als 2 Millionen Quadratkilometern, das vom Mississippi bis zu den Rocky Mountains reichte. Napoleon hatte dieses ehemals französische Territorium 1800 von Spanien zurückerworben, indem er es gegen Teile der Toskana getauscht hatte. Nur drei Jahre später brauchte er Geld, um sich für einen erneuten Krieg mit Großbritannien zu rüsten, und offerierte es den USA. Deren Unterhändler, die eigentlich nur New Orleans für 10 Millionen Dollar erwerben wollten, waren verblüfft, als ihnen Frankreich seine gesamte nordamerikanische Kolonie für 15 Millionen anbot, und schlugen sofort ein.
Da die USA nicht liquide genug waren, mussten sie Kredite bei britischen und niederländen Banken aufnehmen. Für 375 Millionen Dollar im heutigen Wert. 185 Dollar pro Quadratkilometer, verdoppelte die junge Nation ihre Fläche. Und so ging es weiter: 1819 zahlte sie im Adams-Onis-Vertrag Spanien 5 Millionen Dollar für Florida. Mitte des Jahrhunderts wuchsen die USA erneut. Nachdem sie Briten, Franzosen und Spanier um große Teile ihrer Kolonialreiche in der Neuen Welt erleichtert hatten, waren die seit 1821 unabhängigen Mexikaner an der Reihe. 1845 nahmen die USA das von Mexiko abtrünnige Texas als 28. Gliedstaat auf und provozierten den südlichen Nachbarn mit Truppenbewegungen an der Grenze so lange, bis dieser zuschlug. Präsident James Polk ließ den Kongress daraufhin den Krieg erklären, den seine Armee schnell gewann.
1848 musste Mexiko im Vertrag von Guadalupe Hidalgo das Gebiet des heutigen Texas, jenes von Kalifornien, Nevada und Utah sowie fast ganz Arizona, New Mexico, Colorado und Wyoming an die USA abtreten. Die Nation expandierte um weitere 1,4 Millionen Quadratkilometer. Im Gegenzug zahlten die USA 15 Millionen Dollar für Kriegsschäden und übernahmen die Schulden der mexikanischen Regierung bei amerikanischen Bürgern. 1853 erwaren die USA im Gadsen-Kauf zusätzliche 77 000 Quadratkilometer für 10 Millionen Dollar von Mexiko.
1867 gelang den USA ein weiterer Coup: Alaska. Dort waren die Russen 1732 von Sibirien aus auf der Suche nach den begehrten Pelzen von Seeottern erstmals angelandet. Zar Paul I. wirkte 1799 als Patron bei der Gründung der Russisch-Amerikanischen Gesellschaft, der ersten russischen Aktiengesellschaft überhaupt. Sie hatte den Auftrag, neue Siedlungen in Alaska zu gründen, Handel mit Einheimischen zu treiben und das Territorium zu kolonisieren. 1804 errichtete die Gesellschaft ihre erste dauerhafte Siedlung, das heutige Sitka. Russische Missionare bauten Kirchen und versuchten, Ureinwohner zu bekehren. In Alaska kontrollierten 700 Russen ein Gebiet, in das Deutschland 5- und die Schweiz 41-mal passen würde.
Schon bald erstreckten sich die Interessen der Russisch-Amerikanischen Gesellschaft nach Süden. 1812 etablierte diese Fort Ross, 150 Kilometer nördlich von San Franzisco. Pläne für eine stärkere wirtschaftliche Kolonialisierung Kaliforniens wurden jedoch nach dem Tod Alexanders I. und den inneren Wirren infolge des Aufstands der Dekabristen, revolutionärer Offiziere, gegen das autokratischen Zarenregime 1825 aufgegeben. Mehr noch: Die Otter-Bestände waren erschöpft, und die britische Hudson Bay Company bedrängte Fort Ross mit ihrer Handels- und Versorgungsstation in Fort Vancouver. Die Gesellschaft wollte ihren unrentablen Posten deshalb losschlagen. Einen Käufer fand sie 1841 in John Sutter, einem Schweizer Auswanderer, die gerade dabei war, ein New Helvetia in Nordkalifornien aufzubauen.
Auch in Alaska geriet Russland in die Defensive. Angesichts der dünnen Besiedelung fürchtete Zar Alexander II., das abgelegene Territorium im Kriegsfall nicht gegen Großbritannien verteidigen zu können.
Da er den Erzfeind nicht von British Columbia aus nach Alaska und damit an die Grenze zu Sibirien vorrücken sehen wollte und nach dem verlorenen Krim-Krieg (1853-1856) dringend Geld brauchte, beschloss er 1858, das Gebiet an die USA zu verkaufen. In Washington hatte man angesichts des drohenden Bürgerkriegs allerdings zunächst andere Prioritäten. Erst 1867 kam es zum Vertrag. Der Kaufpreis betrug 72 Millionen Dollar, gut 130 Millionen im heutigen Wert. Die USA gewannen weitere 1,5 Millionen Quadratkilometer hinzu.
Die meisten Amerikaner unterstützten den Kauf, den Außenminister Seward ausgehandelt hatte. Kritiker verunglimpften Alaska jedoch als „Sewards Dummheit“ oder „Sewards Eisschachtel“. Aber die USA hatten mit dem neuen Territorium ein Schnäppchen gemacht – ökonomisch und strategisch. Bis heute hat Alaska mehr als 400 Tonnen Gold und damit ein bis zwei Prozent des jemals weltweit geförderten Edelmetalls produziert. Zudem hat der Gliedstaat Zink, Blei, Kupfer und Kohle. Ende der achtziger Jahre stieg Alaska sogar kurz zum größten Ölproduzenten der Nation auf.
Schließlich ist Alaska von enormer strategischer Bedeutung. Sollte Nordkorea die USA mit Nuklearraketen angreifen, flögen diese über die Arktis – das amerikanische Abwehrsystem ist deshalb in Kalifornien und in Fort Greely in Alaska stationiert. Zugleich garantiert ihr nördlichster Gliedstaat den USA Ansprüche auf die schmelzende Arktis, wo ein Viertel der globalen Öl- und Gasvorräten liegen sollen. Kein Wunder, das russische Politiker das Geschäft von 1867 rückabwickeln wollen. Vor allem seit den amerikanischen Sanktionen nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine spielen Putins-Vertraute öffentlich mit diesem Gedanken. Im Jänner 2024 unterzeichnete der Diktator sogar ein Dekret, das Mittel für die Registrierung russischen Eigentums im Ausland bereitstellt – selbst in einstigen Territorien des Zarenreichs und der Sowjetunion.
Trump macht auf Potentat
Insgesamt haben die USA mehr als die Hälfte ihres Territoriums gekauft. Trumps Idee, Grönland zu erwerben, hat also durchaus historische Wurzeln. Und tatsächlich erinnert die Rieseninsel an Alaska: Rohstoffreichtum, vor allem bei kritischen Mineralien wie Seltenerdmetallen: Öl: Anrainerschaft zur Arktis: idealer Stützpunkt zum Aufspüren russischer Landstreckenraketen, die über den Nordpol gen Amerika fliegen: westlichster Teil eines Stützpunktriegels, der Russlands Atom-U-Booete überwachen kann, wenn sie aus ihren arktischen Häfen in den Nordatlantik einfahren.
Doch die Unterschiede sind dramatisch: die USA würden Land nicht von bankrotten Kolonialmächten oder torkelnden Nachbarn übernehmen, sondern von einem Nato-Partner und einer Demokratie. Das ficht Trump nicht an. Ökonomisch halluziniert er die USA ins Industriezeitalter der sechziger Jahre zurück. Außenpolitisch denkt er wie ein Potentat des 19. Jahrhunderts, wo Großmächte den Rest der Welt unter sich aufteilten.
Trump legt mit seiner Brachialrhetorik und seinen Drohungen die Axt an die Wurzel westlicher – und amerikanischer – Stärke: das Allianzsystem, um das ihn die Rivalen in Moskau und Peking beneiden. Bei seinen Expansionsgelüsten könnte der Kongress Trump freilich unterstützen. Kürzlich postete die republikanische Mehrheit des außenpolitischen Ausschusses im Repräsentantenhaus auf X: „Unser Land wurden von Kriegern und Entdeckern aufgebaut“; so heißt es über einer imaginären Karte, die Kana als 51. Gliedstaat zeigt „Es ist unamerikanisch, Angst vor großen Träumen zu haben.“ Für die anderen Demokratien der Welt wäre es dagegen ein Albtraum.
Zum Autor: Stephan Bierling lehrt international Politik an der Universität Regensburg.
Deine Meinung
-
Western Europe also formed